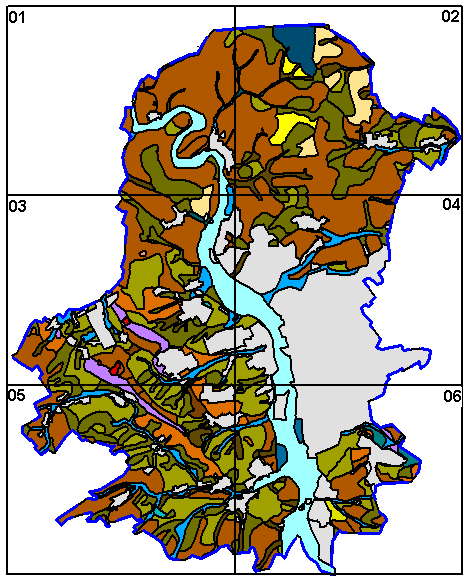Im Untersuchungsgebiet
sind Parabraunerden und Pseudogleye im Offenland sowie Braunerden im
Wald am häufigsten verbreitet.
Die mächtigen Parabraunerden über den Lösslehmdecken
in der Ebene sind von einem stark tonhaltigem Horizont unter dem
Oberboden geprägt und können somit Nährstoffe und Wasser
gut aufnehmen und speichern. Sie eignen sich hervorragend für die
landwirtschaftliche Nutzung.
Die Pseudogleye an den Hangbereichen der oberen Bachläufe
dagegen besitzen einen ständig schwankenden Stauwasserhorizont
und sind somit einem Wechsel von Austrocknung und Vernässung ausgesetzt.
Trotz guter Stoffspeicherfähigkeit sind die Böden daher weniger
für den Ackerbau geeignet.
Die Braunerden sind größtenteils von Wald bedeckt.
Sie überdecken die Sandsteinschichten des Buntsandsteins und besitzen
meist einen hohen Lehmanteil im mittleren, von Eisenoxiden braungefärbtem
Horizont.
Eine Besonderheit bilden die Braunerden über Basalt und Kalk
sowie die Regosol-Braunerden über tonhaltigem oberem Buntsandstein,
die aufgrund ihrer geringmächtigen Humusschicht und des geringen
Wasserspeichervermögens als Extremstandorte hohe Bedeutung für
seltene Lebensräume besitzen.
Entlang der Flussläufe sind die Aueböden (Vega) verbreitet.
Wie die Braun- und Parabraunerden besitzen die Aueböden sehr gute
Speicherfähigkeiten für Wasser und Nährstoffe, unterliegen
jedoch einem periodischem Grundwassereinfluss, der vom Wasserspiegel
des Flusses abhängt. Sie sind daher gegenüber Schadstoffeinträgen
hoch empfindlich.
Die meisten Bach- und Flussauen werden durch Auengley geprägt,
dessen unterster Bodenhorizont ständig dem Grundwasser ausgesetzt
ist. Die Bodeneigenschaften ähneln denen der Aueböden.
Eine weitere Besonderheit sind die flachgründigen (geringmächtige
Oberbodenschicht) Rendzinen über den Kalkbänken der
Grabenzonen. Als trockene Standorte werden sie überwiegend für
die Waldnutzung beansprucht und tragen oft seltene Magerrasengesellschaften.
Die Erklärung der Farben und Kennziffern finden Sie in der Legende, die als eigenständiges Fenster eingeblendet werden kann.
Die abgegrenzten
Ausschnitte werden bei einem Mausklick als eigene Karte angezeigt.
Sie wurden im Maßstab 1 : 25 000 erstellt.